Kommunale Verkehrswende
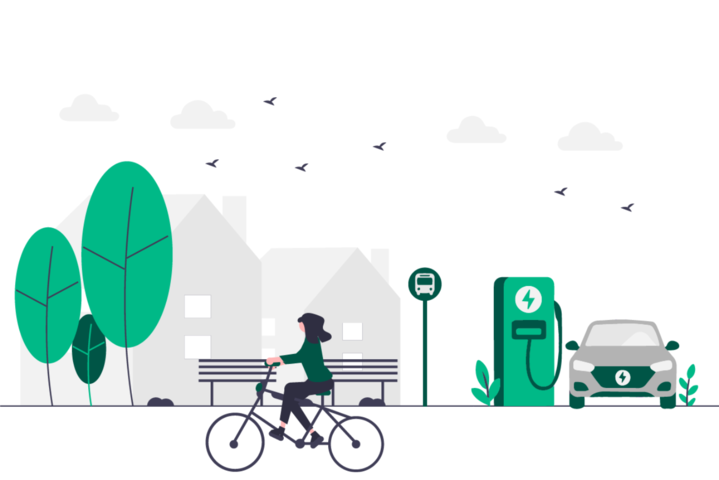
Die Verkehrswende beginnt auf lokaler Ebene
Die Verkehrswende ist ein wichtiger Teil der deutschen Klimapolitik. Damit dieses Vorhaben gelingt, reicht es nicht, auf Veränderungen im privaten Mobilitätsverhalten zu hoffen. Auch die Kommunen selbst müssen handeln: Sie sollen CO₂-Emissionen senken und die Lebensqualität in Stadt und Land steigern. Dazu gehören die Umstellung der Fahrzeugflotten, der Ausbau von Ladepunkten und neue Angebote für klimafreundliche Mobilität.
Die Umsetzung ist für viele Kommunen eine große Aufgabe. Es geht nicht nur darum, Vorgaben von EU und Bund umzusetzen. Technische, finanzielle und organisatorische Hürden müssen ebenfalls bewältigt werden. Die Beschaffungspraxis und Abläufe in der Verwaltung benötigen zudem eine Umstellung. Dafür braucht es Kooperationspartner, die beim Umstieg helfen. Wichtig ist ein integrativer Ansatz, der Umweltschutz, Haushalt und Bürgerinnen/Bürger zusammenbringt.
Städte und Gemeinden müssen Entscheidungen treffen, die zu den Vorgaben von EU und Bund passen und gleichzeitig praktisch umsetzbar sind. Dafür bieten die gesetzlichen Regelungen eine wichtige Orientierung: Sie helfen, Maßnahmen zu planen, Anträge zu stellen und politische Unterstützung zu gewinnen.
Klimaziele werden rechtlich bindend
Die kommunale Verkehrswende ist gesetzlich klar geregelt. Grundlage ist die EU-Richtlinie 2009/33/EG, die als „Clean Vehicles Directive“ bekannt ist. Sie wurde 2019 durch die Richtlinie (EU) 2019/1161 verschärft. Seitdem gelten verbindliche Quoten: Städte und Gemeinden müssen beim Fahrzeugkauf verbindliche Umweltvorgaben einhalten.
Ab dem Jahr 2026 gelten Pkw und leichte Nutzfahrzeuge nur noch dann als „sauber“, wenn sie im Alltag keine Abgase ausstoßen. In der Praxis bedeutet dies, dass es sich um reine Elektrofahrzeuge oder Wasserstoffautos handeln muss. Übergangsweise sind bis Ende 2025 noch Fahrzeuge erlaubt, die höchstens 50 Gramm CO₂ pro Kilometer ausstoßen. Für schwere Fahrzeuge wie Busse oder Lastwagen gibt es keinen festen CO₂-Grenzwert. Hier ist entscheidend, wie der Antrieb funktioniert.
Diese Fahrzeuge gelten als sauber, wenn sie zum Beispiel mit folgenden alternativen Kraftstoffen fahren:

Hinzu kommt, dass der Anteil an emissionsfreien Bussen und Lkw in den kommenden Jahren deutlich wachsen muss.
In Deutschland setzt das Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungsgesetz (SaubFahrzeugBeschG) die EU-Vorgaben in deutsches Recht um. Kommunale Auftraggeber müssen von 2026 bis 2030 mindestens 38,5 Prozent ihrer neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeuge mit sauberem Antrieb beschaffen. Bei Linienbussen liegt die Quote sogar bei 65 Prozent – und die Hälfte davon muss ganz ohne Abgase fahren. Für Behörden des Bundes gelten zum Teil andere Quoten. So sollen beim Bund im gleichen Zeitraum 42,5 Prozent der neuen leichten Nutzfahrzeuge sauber fahren.
Zusätzlich gibt es weitere Regeln aus Europa, die Städte und Gemeinden betreffen. Das Programm „Fit for 55“ verpflichtet alle EU-Staaten, ihre Emissionen bis 2030 deutlich zu senken. Auch die „AFIR-Verordnung“ betrifft Kommunen: Sie schreibt vor, dass mehr öffentliche Ladepunkte gebaut werden. Dafür sind nicht nur Bund und Länder zuständig, sondern auch die Städte selbst. Kommunen müssen also aktiv beim Ausbau der Infrastruktur mitwirken.
Für Städte und Gemeinden sind die gesetzlichen Vorgaben mehr als nur bloße Regulierung: Sie sind die Grundlage, um Projekte zu planen, Anträge zu stellen und politische Entscheidungen zu treffen. Die Vorgaben sorgen also für mehr Sicherheit und Klarheit bei Entscheidungen. Sie helfen, Projekte gegenüber Rathaus, Stadtrat oder Öffentlichkeit zu erklären. Wer zum Beispiel einen neuen Betriebshof plant oder den Fuhrpark neu aufstellt, muss die gesetzlichen Quoten beachten. Gleichzeitig können sich kommunale Entscheidungsträger auf diese Regeln stützen, um Unterstützung und Förderungen zu bekommen.
Neue Antriebe brauchen neue Flottenstrategien
Kommunale Fuhrparks bestehen aus vielen verschiedenen Fahrzeugen mit ganz unterschiedlichen Anforderungen. Pkw und Transporter für Verwaltung oder Bauhöfe lassen sich meist gut durch Elektrofahrzeuge ersetzen. Ihre Reichweite von 200 bis 400 Kilometern reicht im Alltag oft aus. Schwieriger ist die Umstellung bei großen Fahrzeugen wie Müllwagen, Kehrmaschinen oder Feuerwehrfahrzeugen: Sie brauchen mehr Energie, sind länger im Einsatz oder haben energieintensive Technik an Bord. Die Auswahl an elektrifizierten Modellen für diese Fahrzeuge ist bisher klein.
Kommunen müssen deshalb genau prüfen, welcher Antrieb für welche Anforderung passt. Dabei sind verschiedene Fragen zu klären:
- Wie weit fährt das Fahrzeug pro Tag?
- Wie lange ist es im Einsatz, wie lang ist die Standzeit?
- Wie viel Energie verbraucht die Technik an Bord?
- Gibt es bereits passende Modelle auf dem Markt?
Die größte Rolle spielen Elektroautos bei der Verkehrswende: Sie stoßen keine lokalen Emissionen aus und nutzen Energie besonders effizient. Im Nahverkehr sind Elektrobusse inzwischen weit verbreitet. Ihre Reichweite von 250 bis 350 Kilometern reicht im Alltag meist aus. Für längere Strecken oder schwere Einsätze können Wasserstofffahrzeuge in Frage kommen. Das gilt zum Beispiel für Müllfahrzeuge, die im Schichtbetrieb eingesetzt werden. Plug-in-Hybride werden heute kaum noch eingesetzt.
Elektrische Nutzfahrzeuge sind teuer: Ein elektrifiziertes Müllfahrzeug kostet schnell über 500.000 Euro. Auch Elektrobusse sind 20 bis 30 Prozent teurer als Dieselbusse. Außerdem kommt es häufig zu Lieferproblemen. Kommunen müssen deshalb früh planen und Ausschreibungen rechtzeitig starten. Auf Dauer lohnt sich der Umstieg trotzdem: Strom ist günstiger als Diesel und der Wartungsaufwand fällt geringer aus. Im laufenden Betrieb müssen Ladezeiten und Pausen in den Arbeitsablauf passen. Außerdem braucht es geschultes Personal, passende Technik und eine durchdachte Steuerung der Fahrzeuge.
Keine Verkehrswende ohne Ladeinfrastruktur
Für die Verkehrswende braucht es viele Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge. Vor allem in Städten haben viele Menschen keinen eigenen Stellplatz mit Stromanschluss. Deshalb sind die Kommunen gefragt: Sie müssen öffentliche Ladepunkte aufbauen. Diese neue Technik gehört zur öffentlichen Daseinsvorsorge.
Wichtig ist ein flächendeckendes Netz mit:
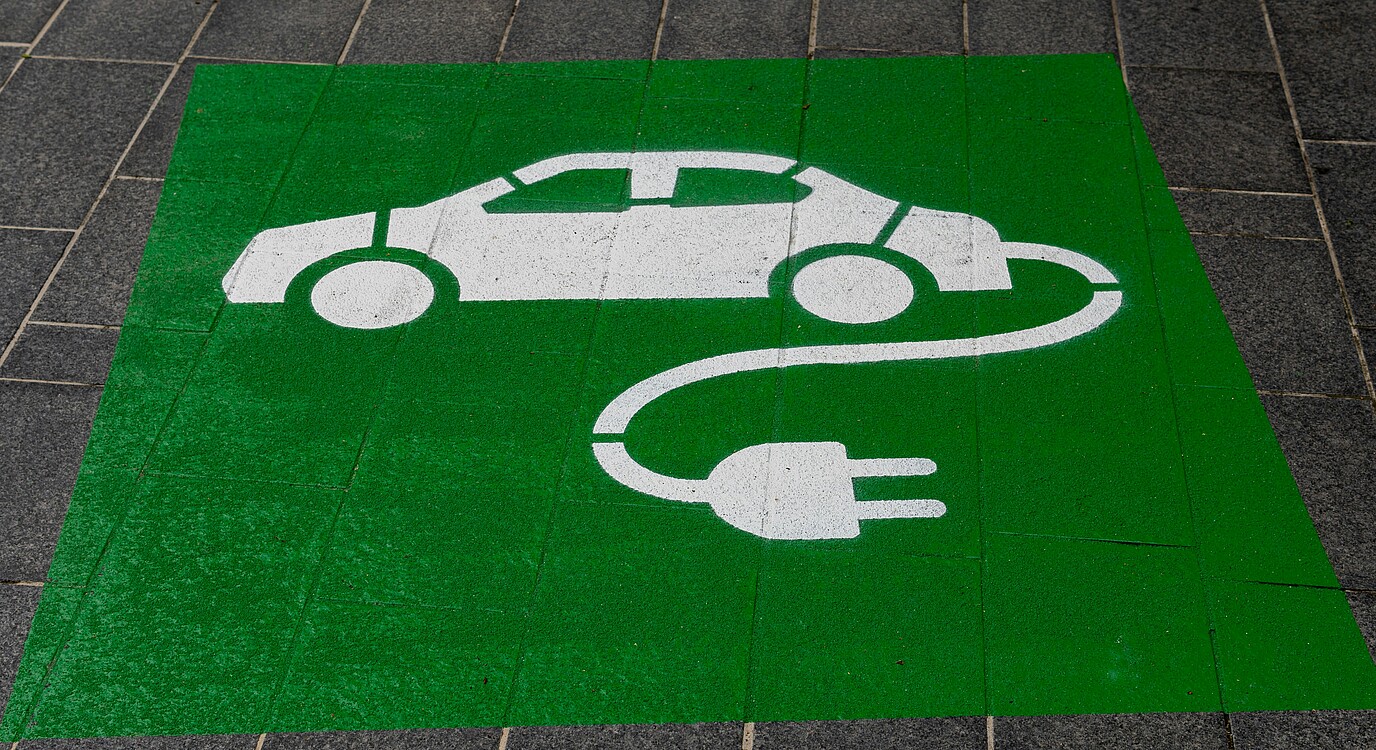
Neben klassischen Ladesäulen setzen Städte auch auf neue Ideen:
- In Bochum werden Straßenlaternen zum Beispiel so umgebaut, dass man dort E-Autos laden kann. Dies spart Platz und erfordert keine aufwendigen Bauarbeiten.
- In Köln testet man „Ladebordsteine“: Hier sind Ladepunkte platzsparend in den Bordstein integriert.
Private Lademöglichkeiten in Wohnhäusern oder an Arbeitsplätzen sind zwar immer weiter verbreitet. Trotzdem braucht es genug öffentliche Ladepunkte, damit die Verkehrswende funktioniert. Um den Ausbau zu unterstützen, stellt die Bundesregierung umfangreiche Fördermittel bereit. Im Klima- und Transformationsfonds befinden sich dafür aktuell rund 900 Millionen Euro. Trotzdem können Städte und Gemeinden den Ausbau nicht allein stemmen. Sie müssen dabei eng mit Energieversorgern und privaten Anbietern zusammenarbeiten, damit überall genug Ladepunkte entstehen und diese leicht nutzbar sind.
BALM und NKI als zentrale Fördergeber
Der Umstieg auf Elektromobilität ist für viele Kommunen teuer. Bund und Länder helfen deshalb mit verschiedenen Förderprogrammen. Ein zentrales Programm ist das „Förderprogramm Elektromobilität“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Es richtet sich speziell an Städte und Gemeinden. Gefördert werden unter anderem neue Fahrzeuge, Ladepunkte auf kommunalem Grund und Planungskonzepte für Betriebshöfe. Zuständig für die Umsetzung ist seit 2023 das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM).
Auch die Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstützen Kommunen. Gefördert werden unter anderem Mobilitätskonzepte, die Umstellung von Fuhrparks sowie der Aufbau von Ladepunkten auf kommunalen Flächen. Weitere Programme kommen von den Bundesländern. Sie berücksichtigen regionale Besonderheiten und fördern zum Beispiel Fahrzeuge, Infrastruktur oder Personalstellen. Oft lassen sich diese Mittel mit Bundesförderungen kombinieren.
Um Förderchancen optimal zu nutzen, müssen Anträge schon vor Projektbeginn gestellt werden. Kommunen sollten früh planen und alle Unterlagen vollständig einreichen. Wer sich beraten lässt oder mit anderen Städten zusammenarbeitet, hat bessere Chancen auf eine schnelle Bewilligung.
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden
Melden Sie sich für den Newsletter von GVV Kommunal an. Sie erhalten hilfreiche Informationen rund um das Thema Kommunalversicherung kostenlos per E-Mail.